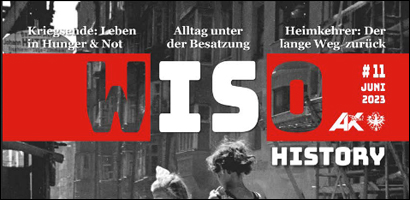
Wirft man einen Blick auf die Tiroler Wirtschaft und Gesellschaft der unmittelbaren Nachkriegszeit, dann kommt man an allgegenwärtiger Knappheit nicht vorbei. Das Land blieb für viele Menschen für mehrere Jahre nach dem Kriegsende eine Mangelgesellschaft, ja es war in den ersten Wochen und Monaten faktisch zurückgeworfen auf die reine Selbstversorgung, vor allem bei der Energie und anfangs auch der Ernährung. Es gab teils schlicht keine Möglichkeit, von außerhalb Güter zu bekommen, auch solche des Grundbedarfs, und damit hieß es nahezu überall vor allem, Not zu verwalten.
BALKON-HÜHNER UND SCHLANGESTEHEN
Dabei war oft ein Tausch Ware gegen Ware notwendig, weil es noch lange dauern sollte, bis so etwas wie stabiler Geldwert wieder hergestellt war und es insbesondere an konvertiblen Devisen stark mangelte. Tauschhandel galt selbst für den Außenhandel (z. B. Tiroler Holz gegen italienisches Obst und Gemüse), aber auch auf privater Ebene kehrte der Naturaltausch zurück. Selbst Geschäftsleute nahmen oft lieber „Bauernvaluta“ statt Geld. Naturalien standen daher hoch im Kurs, denn schließlich konnte sich Tirol (und so ist das ja noch heute) aus eigener Produktion heraus nicht ausreichend ernähren. Direkt nach dem Krieg war man aber darauf angewiesen und die allerersten Nahrungsmittelzuteilungen umfassten da-her nur Mengen von unter 900 Kilokalorien täglich, was etwa die Hälfte eines bei leichter Arbeit gerade noch ausreichenden Bedarfs ist. Während die bäuerliche Bevölkerung damit einen Rückschritt in den früher üblichen periodischen Mangel er-lebte, der das Überleben aber nicht gefährdete, waren die Folgen für die Stadtbevölkerung besorgniserregend und führten zur Aktivierung aller Reserven, wie Äckern auf Rasenflächen, Balkon-Hühnern oder auch häufigen Besuchen bei „Bekannten“ am Land. Erst im Sommer 1948 erreichten die Zuteilungsmengen regelmäßig wieder ein ausreichendes Niveau und das Nachkriegsstraßenbild sehr locker sitzender Kleidung infolge von Unterernährung normalisierte sich. Noch bis in die 1950er-Jahre gab es trotzdem „fleischlose Tage“ und Butter oder Milch nur gegen Bezugscheine.Auch „Recycling“ war weit verbreitet, wenn auch aus der Not heraus. Es war schlicht nötig, jeden Rest zu verwerten, weil neue Güter oder Rohstoffe nicht zu bekommen waren oder nicht bezahlt wer-den konnten. Es war selbstverständlich, dass Kinder nach der Schule Papier, Kleidung oder Metall sammeln gingen. Wo es wiederum Produkte zu kaufen gab, konnte man „Schlangestehen“ beobachten, wo-bei es dort wenigstens etwas zu verteilen gab. Und „Verteilen“ musste man wörtlich nehmen, denn es herrschte lange faktische Planwirtschaft, während die Marktwirtschaft sich eher im Verborgenen abspielte. Denn neben der Verteilung von Gütern zu moderaten Preisen und gegen Bezugsscheine, wo das Problem primär darin bestand, dass es von allem immer zu wenig gab, gab es auch die unvermeidlichen Begleiter je-der Knappheitsgesellschaft: Schmuggel, Schwarz- und Schleichhandel sowie Dieb-stähle und sogar Raubüberfälle waren an der Tagesordnung. Am Schwarzmarkt, wo man eine größere Warenpalette beziehen konnte, mussten dafür erheblich höhere, im wahrsten Sinne des Wortes „marktgerechte“ Preise bezahlt werden. Und noch 1949 musste selbst die Tiroler Handelskammer den Konditoreien infolge ausbleiben-der Zuteilungen raten, sich Mehl auf dem Schwarzmarkt zu beschafften. Während die Preise dort immerhin regelmäßig mit der besseren Versorgung sanken, war die offizielle Wirtschaft von starker Inflation geprägt: Von 1946 auf 1947 verdoppelten sich die Lebenshaltungskosten, bis 1948 hatten sie sich verdreifacht, bis 1949 fast vervierfacht und auch in den Jahren danach blieb die Teuerung noch hoch. Auch „slumartige“ Wohnverhältnisse waren in den ersten Nachkriegsjahren vor allem in Innsbruck keine Seltenheit. Die Reparatur und der Neubau von Wohnungen wurden daher als brennendste Gegenwarts-frage gesehen. Viele mussten vor allem bei Glasreparaturen teils jahrelang vertröstet werden. Man half sich damit, Glas aus Bilderrahmen herauszunehmen und in Fensterscheiben einzusetzen, aber noch 1947 bekam man Glas teils nur über ärztliche (!) Gutachten, um zumindest Schwerkranke oder Neugeborene vor allzu großer Kälte zu schützen. Ähnliches galt für die private Energieversorgung, wo im Herbst 1945 gemahnt wurde, man möge nie gleichzeitig Kochen und Heizen und wenn, dann nie über eine Zimmertemperatur von 17 Grad. Dabei konnte Nachkriegstirol vor allem auf Holz und Wasserkraft zurückgreifen, Kohle gab es hingegen nur sehr beschränkt. Auch die Wasserkraft steckte erst im Auf-bau, viele Kraftwerksbauten erfolgten erst später und so manche Talschaft war noch nicht einmal ans Stromnetz angeschlossen. Also blieb oft nur das Holz, was nicht ohne Folgen für die Bewaldung speziell um die Städte war, wie Fotos aus jener Zeit deutlich zeigen. Konsequenterweise wurde Holz auch zum Tanken (!) verwendetet und 1946 fuhren in Innsbruck rund 40 Prozent der Lkw mit Holzvergasern. An Individualverkehr war unter diesen Bedingungen kaum zu denken, außer mit Fahrrädern, die entsprechend begehrt waren. Vielmehr war man auf öffentliche Verkehrsmittel und oft auf die eigenen Füße angewiesen.
START AUS TRÜMMERN BEI NIEDRIGEN LÖHNEN
Entsprechend stockend lief die Industrieproduktion an. Manche Betriebe waren überhaupt zerstört, manche wegen unklarer Eigentumsverhältnisse faktisch inaktiv oder standen noch länger unter kommissarischer Leitung, andere wieder konnten aus Mangel an Rohstoffen kaum etwas erzeugen. Auch Reparationen an die Siegermächte waren ein Thema, wenn auch weit weniger als in der sowjetischen Besatzungszone. Da aber die meisten Betriebe bei Kriegsende in deutschem Besitz standen, wurden sie als Feindeigentum betrachtet, was Begehrlichkeiten der französischen Besatzer weckte. Manche wurden daher durch Abtransport der Betriebsmittel faktisch stillgelegt, in anderen wurden zumindest die wertvollen Maschinen beschlagnahmt. Viele Unter-nehmen begannen daher mit dem, was vorhanden war, und daher oft auf einem geradezu primitiven Niveau mit improvisierten Maschinen, erschöpften Arbeitskräften und in ungewohnten Geschäftsfeldern. Viele Betriebe entstanden so nach dem Krieg neu, teils notgedrungen, teils aber auch dank Förderungen. Ab 1948 waren so genannte ERP-Kredite vor allem für Wirtschaftszweige verfügbar, von denen man sich nachhaltige Impulse für die österreichische Volkswirtschaft und insbesondere für den Außenhandel versprach. Durch diese Geldmittel aus dem Marshall-Plan waren Neuansiedlungen und Neugründungen möglich, aber auch verschiedene Infrastrukturprojekte, die man sonst nicht hätte finanzieren können. Von niedrigstem Niveau wuchs daher die Industrieproduktion in Tirol nach dem Zweiten Weltkrieg schnell deutlich an, wobei damals die Textilindustrie neben der Eisen- und Metallindustrie der wichtigste Sektor war und Swarovski und die Jenbacher Werke mit je rund 1.500 Beschäftigten die größten einzelnen Arbeitgeber. So stabilisierte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt langsam, der allerdings wie die gesamte Wirtschaft in den Jahren nach dem Krieg noch stark reguliert war. 1950 gab es in Tirol neben vielen Beschäftigten in der Landwirtschaft insgesamt rund 100.000 unselbständig Beschäftigte bei knapp 5.000 Arbeitslosen (davon jeweils zwei Drittel Männer), aber nur rund 2.000 offene Stellen. Auch Arbeit war daher noch knapp und die Löhne entsprechend unter Druck. Sie reichten 1950 gerade, um einen bescheidenen Lebensstandard zu finanzieren, wobei es immer noch nicht allzu viel zu kaufen gab und die Preise ständig stiegen.
DER STRUKTURWANDEL WIRFT SCHATTEN VORAUS
Man vergisst leicht, wie stark Tirol in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch agrarisch geprägt war. Noch 1948 waren in Tirol mehr Menschen in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt als in der Industrie. Erst die folgenden Jahre brachten dann einen nachhaltigen und weitreichenden Strukturwandel, den man freilich in seiner Bedeutung kaum überschätzen kann. Schließlich veränderte sich dadurch in einer sehr kurzen Zeitspanne von nur ein bis zwei Generationen ein über Jahr-hunderte bestehender religiöser, gesellschaftlicher und ökonomischer Zustand, der das Land und seine Menschen tief geprägt hatte. An die Stelle eines „Bauernlandes“, als das sich Tirol direkt nach dem Krieg noch sah und auch sehen konnte, trat eine moderne Industriegesellschaft, die sich bald noch weiter zur Dienstleistungsgesellschaft wandeln sollte, wobei trotz aller Widerstände die im Krieg gestiegene Frauenbeschäftigung schon allein aus ökonomischen Gründen gekommen war, um zu bleiben.Ähnlich schnell etablierte sich ja auch der Tourismus, nicht zuletzt in vormals stark agrarisch geprägten Randlagen, der nach dem Krieg relativ schnell an die Aufbauarbeit der Zwischenkriegszeit anknüpfen konnte. Dominierten anfangs noch französische Touristen, überschritten 1950, als erstmals wieder deutsche Gäste in größerer Zahl kommen konnten, die Nächtigungen bereits die Zwei-Millionen-Grenze. Diesen Aufschwung verdankte der „Fremdenverkehr“ nicht zuletzt seiner Rolle als Devisenbringer. Wintertourismus stand dabei aber lange noch im Schatten des Sommers, gab es doch in den 1940er-Jahren erst eine Handvoll „Aufstiegshilfen“ im ganzen Land. In der Tat, die Zeiten sollten sich in den folgenden Jahrzehnten schnell und sehr grundlegend ändern.
Beitrag: WISO – History
Andreas Exenberger | AK-Tirol WISO
WISO