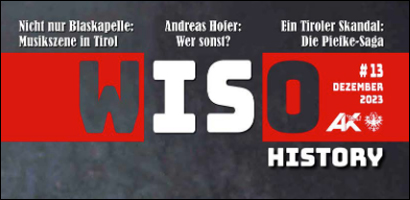
Was die Heimat ausmacht, das ist auch von der Wirtschaft mitbestimmt. Sie verändert die Landschaft, sie prägt Identität und sie schafft oder verschließt Möglichkeiten. Die Tätigkeiten, denen wir nachgehen, oder das Umfeld, in dem wir leben, bestimmen maßgeblich mit, wie wir uns selbst und unsere Umgebung wahrnehmen. Wie Tirol dabei gesehen wird, das hat manchmal mehr mit der Vergangenheit als mit der heutigen Realität zu tun.
Werfen wir einen Blick in die Ge-schichte zurück. Vor 200 Jahren war Tirol ein Bauernland, dessen Bevölkerung zumeist in Dörfern und in oft schwer zugänglichen Tälern lebte. Alter-nativen waren kaum möglich und der Lebensweg war meist vorgezeichnet. Auch der katholische Glaube war ein zentrales Element der Organisation des Alltags und der Gesellschaft. Andere durften nicht auffallen und noch im 19. Jahrhundert mussten viele sogar die Heimat wegen ihres Glaubens verlassen. Die Landwirtschaft war arbeits-intensiv und wetterabhängig, daher war Armut allgegenwärtig. Gerade vor etwa zwei Jahrhundert etwa litten die Menschen noch unter den Folgen der Napoleonischen Kriege und eines Vulkanausbruchs am anderen Ende der Welt. Die Bevölkerung wuchs nur wenig und noch bis weit ins 20. Jahrhundert war Tirol ein Auswanderungsland.So war das im Wesentlichen auch in den Jahrhunderten davor, wobei solche Verallgemeinerungen natürlich immer Lücken aufweisen. In manchen Gegenden hat speziell der Silberbergbau oder die Salzgewinnung auch für einen gewissen Reichtum gesorgt und die Basis des Lebensunterhalts war insgesamt reichhaltiger als die reine Landwirtschaft. Auch in den Dörfern gab es Handwerk und Handel und die Städte waren sowieso eine andere Welt, die teils auch schon früher als Durchzugsorte (speziell von Nord nach Süd) naturgemäß eher welt-offen waren, Innsbruck als Residenzstadt manchmal geradezu kosmopolitisch. Und nicht überall im Land war der Mangel gleichermaßen groß, nur aus gewissen Landes-teilen zogen etwa „Schwabenkinder“ nach Süddeutschland.Aber die Städte waren kleine Inseln in einem agrarischen Meer und erst mit den Veränderungen im 19. Jahrhundert zog ein nachhaltiger Wandel ins Land im Gebirge ein. Die beiden wichtigsten waren die Eisenbahn und die Industrie. Bereits in den 1850er-Jahren war das Unterinntal bahntechnisch erschlossen worden, darauf folgten die Brennerbahn, die Pustertalbahn und die Giselabahn (Brixental) und in den 1880er-Jahren schließlich die Arlbergbahn. Damit wurde sowohl der Transport von Personen, als auch der von Waren revolutioniert. Das begünstigte die Ansiedlung von größeren Gewerbebetrieben, aus denen sich im 20. Jahrhundert eine florierende Industrie entwickeln sollte. Dadurch aber änderte sich das Leben und überall dort, wo es zur Modernisierung gekommen war, stieg zumindest moderat auch der Lebensstandard. Ein Zuzug in die Städte wurde interessanter, mit dem auch eine Befreiung von gewissen dörflichen Zwängen verbunden war. Der Raum, der heute Innsbruck ist (und der damals noch mehrere Gemeinden war), verdoppelte etwa seine Bevölkerungszahl allein zwischen 1880 und 1910 und beherbergte dann etwa ein Fünftel der damals etwa 300.000 Menschen im heutigen Bundesland Tirol.Trotzdem hatte die Vorstellung von Tirol als einer ländlichen und landwirtschaftlichen Region vor einem Jahrhundert noch eine gewisse Gültigkeit. Im Jahr 1920 etwa betrug der Anteil der Bevölkerung, der von der Landwirtschaft lebte, immerhin noch 55 Prozent, und er sollte bis 1951 auch nur auf 37 Prozent fallen. Man muss dabei aber auch gleich mit einem ersten Missverständnis aufräumen: Auch damals reichte dieser Anteil nicht aus, um die Gesamtbevölkerung zu ernähren. Zwar war die Selbstversorgungsquote mit Grundnahrungsmitteln damals höher als heute, aber die Lage war schon immer prekär, wo man mit den Erträgen aus der Viehwirtschaft anderswo auch Grundnahrungsmittel einkaufen musste. So konnte es auch in Krisen immer wieder zu gravierenden Versorgungsproblemen kommen, wie etwa nach den beiden Weltkriegen.
VOM MANGEL ZUM WOHLSTAND
Der wirtschaftliche und soziale Wandel war aber nicht mehr aufzuhalten und er war für die Menschen insgesamt eine große Verbesserung. Der durchschnittliche Lebensstandard in Tirol hat sich im 20. Jahrhundert ausgesprochen positiv entwickelt und auch seine Verteilung ist eindeutig gerechter geworden. Harte Lebensbedingungen sind mittlerweile weitgehender materieller Sicherheit gewichen. Man könnte zusammen-fassend festhalten, dass in Tirol eine allgemeine Mangelgesellschaft im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer stabilen Wohlstandsgesellschaft geworden ist. Dieser Wandel fügt sich dabei in einen allgemeinen Trend, er war aber auch hart erarbeitet und politisch erkämpft. Eine wirkliche Maschinisierung der Landwirtschaft geschah erst nach dem Zweiten Weltkrieg und hat in der Folge dazu beigetragen, dass der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten mittlerweile in Tirol sogar unter dem Österreichschnitt bei kaum noch einem Prozent liegt. Der Wohlstand basierte da aber bereits zunehmend auf einer von Anfang an stärker mechanisierten Industrie, die auch in kleineren Orten entstand (wie Wattens, Jenbach, Kundl oder Breitenwang) und wo der Beschäftigungsanteil bis 1961 auf 43 Prozent anstieg.Tirol war damit innerhalb einer Generation zum Industrieland geworden. Zur gleichen Zeit expandierte auch der Tourismus, nicht zuletzt als große Chance speziell für manche Talschaften, die für Industrieansiedlungen nicht in Frage kamen, und gera-de der Wintertourismus auch für Dörfer, die besonders abgelegen waren. Sowohl Industrie als auch Tourismus verhinderten damit weitere Abwanderung (ja, sie führten bald sogar zu Zuwanderung) und hatten vielfältige positive Effekte für die Wirtschaft im Land (die negative Auswirkungen in der Regel weit überwogen). Die beiden Wirtschaftszweige passten aber natürlich nicht ganz zusammen, denn wer möchte schon in einer Industrieregion Urlaub machen. So ist es wohl kein Zufall, dass der Tourismus in der öffentlichen Wahrnehmung einen größeren Stellenwert einnimmt, obwohl die Industrie immer einen größeren Beitrag zur Wirtschaftsleistung stellte.Es sollte dann kaum eine weitere Generation dauern, bis aus dem Industrieland eine Dienstleistungsgesellschaft geworden war. Mittlerweile leben bereits annähernd drei Viertel der Menschen von einer Beschäftigung in diesem Sektor. Das ist vor allem der wachsenden Bevölkerung und einem hohen Innovationsgeist zu verdanken. Nahezu täglich entstehen neue Unternehmen mit guten Ideen, von denen sich viele auch als internationale Erfolge erweisen. Es sind mittlerweile außerdem vor allem öffentliche Dienstleistungen, die viele Menschen beschäftigen, und nicht zufällig sind die Tirol Kliniken und die Universität Innsbruck zwei der größten Arbeitgeber im Land und nicht mehr nur Industriebetriebe wie Swarovski, Sandoz, die Jenbacher Werke oder Plansee. Dazu kommen die Landesverwaltung und insbesondere das Schulwesen, oder auch Handelsunternehmen wie MPreis.Mit diesem Strukturwandel ging auch eine Ausweitung der offiziellen Frauenbeschäftigung einher. Gearbeitet haben Frauen in Tirol natürlich immer, nur eben meist zuhause (am Hof oder im Familiengewerbe), die Lohnarbeit außer Haus nahm aber erst im 20. Jahrhundert wirklich zu. Das galt auch für Männer, aber weit stärker für Frauen: Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen in Tirol noch doppelt so viele Männer wie Frauen einer unselbständigen Beschäftigung nach, inzwischen beträgt der Unterschied nur mehr ein Zehntel. Eine Schattenseite dabei ist, dass das nicht in selbem Umfang für das Beschäftigungsausmaß gilt (die Teilzeitquote von Frauen ist deutlich höher als die der Männer) und auch nicht für die Bezahlung, leider nicht einmal bei gleicher Tätigkeit.Damit hängt auch zusammen, dass die Familien kleiner werden, heute mit Haushaltsgrößen von 2,2 Personen praktisch gleich groß wie im Rest von Österreich. Dieser Fokus auf die Kernfamilie ist auch ein Wohlstandsphänomen, denn solche Lebensentwürfe muss man sich leisten können. Denn gleichzeitig hat sich mit insgesamt steigendem Einkommen auch der allgemeine Wohlstand stark erhöht, sodass heute bei stark gestiegener Bevölkerung (eine Verzweieinhalbfachung in den letzten hundert Jahren) trotzdem weit mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, insbesondere – bei aller Knappheit der Flächen in Tirol, die Wohnen ja auch immer teurer macht – eine viel bessere Wohnsituation als irgendwann in der Geschichte.Wir sollten daher nicht zu nostalgisch an oft mehr eingebildete als reale Verhältnis-se in der Vergangenheit denken, denn oft war diese Vergangenheit weit weg von der Idylle, die wir heute damit verbinden wollen. Tirol war traditionell ein Bauernland, was man heute vor allem an der Landschaft noch sieht, die inzwischen auch stark vom Tourismus geprägt und gepflegt ist. Tirol war auch ein Industrieland und insgesamt verdanken wir vor allem diesem Wirtschaftszweig den Wohlstandszuwachs im 20. Jahrhundert. Tirol ist aber inzwischen vor allem ein Dienstleistungsland, wo wir uns durch die gegenseitige Versorgung unseren Wohlstand immer stärker selbst schaffen und auch in eine intakte Umwelt investieren. Tirol ist daher auch immer attraktiver und bereits seit Jahrzehnten zum Einwanderungsland geworden. Und das alles ist doch eigentlich eine gute Sache. Wir sollten uns dessen aber vielleicht auch bewusster sein, weil es eine gegenseitige Abhängigkeit bedeutet. Wirtschaftlich sind wir daher vielleicht sogar noch mehr als in der Vergangenheit darauf angewiesen, dass wir gut zusammenarbeiten und die Beiträge aller zu unserem gemeinsamen Wohlstand entsprechend wertschätzen.
Beitrag: WISO – History
Andreas Exenberger | AK-Tirol WISO
WISO – Dezember 2023